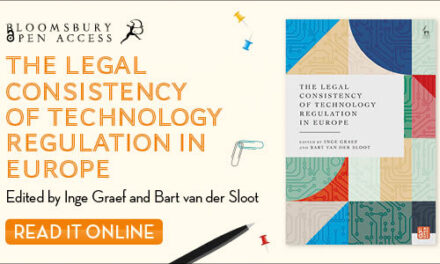#MTM25 – Europatag des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR) in Kooperation mit der BLM
Vom 22. bis 24. Oktober 2025 fanden die #MTM25 – Medientage München im House of Communication unter dem Motto WTFuture?! statt. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Medienwelt, die Herausforderungen durch KI, Plattformregulierung und eine zunehmend fragmentierte Öffentlichkeit.
Den mit diesen Themen zusammenhängenden regulatorischen Fragen widmete sich am 24. Oktober 2025 der Europatag, den das Institut für Europäisches Medienrecht (EMR) erneut in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gestaltete.
Zur Begrüßung sprach Prof. Dr. Stephan Ory (Institut für Europäisches Medienrecht). Es folgten Impulse von Christian Horak, Ministerialdirektor in der Bayerischen Staatskanzlei, und Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Einen Überblick über die europäische Medienregulierung und den aktuellen Stand der Brüsseler Gesetzesinitiativen gab Prof. Dr. Mark Cole, Wissenschaftlicher Direktor des EMR, und lenkte damit den Blick auf Brüssel. Aus Brüssel berichtete im anschließenden Dialog Kai Zenner, Berater des Europaabgeordneten Axel Voss, aus „Brüsseler“ Perspektive.
Das erste Panel WNWN? What now, what next? befasste sich mit den Erwartungshaltungen an die EU-Regulierung aus Sicht von Medienunternehmen, Plattformen und Aufsichtsbehörden. Inhaltlich stand die Frage im Zentrum, wie Medienregulierung demokratische Werte stärken kann, ohne Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu behindern. Vorweg per Video zugeschaltet berichtete Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, über aktuelle Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu neuen Staatsverträgen (DMStV, JMStV) und betonte die Bedeutung von Transparenz und Auffindbarkeit journalistischer Inhalte. In der Diskussion zeigte sich ein breites Meinungsspektrum: Während Daniela Beaujean (VAUNET) einer Anpassung der AVMD-Richtlinie skeptisch gegenüberstand, warnte Peter Matzneller (Netflix) vor einer Fragmentierung des Marktes. Dr. Moritz Holzgraefe (YouTube/Google) betonte die Chancen des geplanten Digital Omnibus für den digitalen Binnenmarkt, während Dr. Tobias Schmid (LfM NRW) den Optimismus etwas dämpfte und vor einer zunehmenden Fragmentierung und Probleme bei der Durchsetzung bestehender Regeln ansprach. Die Moderation des Panels lag bei Prof. Dr. Mark Cole.
In der folgenden Keynote Transformation von Werbung durch AI: Zwischen Outcomes & Answer Engines lenkte das EMR-Vorstandsmitglied, Dr. Daniel Knapp, den Blick auf die Bedeutung von KI für den Werbemarkt.
Der Nachmittag des Europatages stand ganz im Zeichen von KI. Zunächst widmete sich das Panel „May I? Please?“ Oder: Wie funktioniert das Trainieren von KI mit urheberrechtlich geschützten Inhalten? den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz urheberrechtlich geschützter Werke im Training von KI-Modellen. Dabei ging es um die Reichweite von Text- und Data-Mining-Schranken (TDM), Lizenzierungsfragen und die Verantwortung von Anbietern und Rechteinhabern. Dr. Amit Datta, Associate General Counsel des Heidelberger KI-Unternehmens Aleph Alpha, erläuterte, wie sein Unternehmen Daten für das Training generiert – u.a. durch lizenzierte Datensätze. Dr. Kai Welp, General Counsel/Director der GEMA, schilderte dagegen die Risiken des bestehenden Systems. Eine anhängige Klage der GEMA zeige, dass KI-Modelle bereits urheberrechtlich geschützte Musik nahezu identisch reproduzieren können – im konkreten Fall den Song „Mambo Nr. 5“. Dr. Roland L. Klaes, Mitglied der Geschäftsführung des Verlags C.H. Beck, stellte das Modell seines Hauses vor, bei dem Autoren an KI-basierten Erlösen beteiligt werden. Am Ende der Diskussion waren sich die Teilnehmenden einig: Das Training von KI-Modellen dürfe nicht in Länder ausgelagert werden, in denen kein wirksamer Urheberrechtsschutz besteht. Lizenzmodelle müssten auf maschinenlesbaren Opt-out-Möglichkeiten beruhen, und Text- und Data-Mining solle weiterhin möglich bleiben – allerdings nur bei größtmöglicher Sorgfalt im Umgang mit den Rechten Dritter.
Den Abschluss des Europatages bildete das von EMR-Vorstandsmitglied, Kristin Benedikt, moderierte Panel Wer „überwacht“ was? – Von nationalen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden zur „KI Marktüberwachungsbehörde“. Im Mittelpunkt der Diskussion von Andrea Sanders-Winter, BNetzA, Meike Kamp, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und Dr. Annette Schumacher, BLM stand die zentrale Frage, welche Aspekte von KI-Anwendungen beaufsichtigen wird. Die Diskussion machte deutlich, dass die Vielzahl neuer Regelwerke Koordination und Kooperation zwischen Aufsichtsbehörden erfordert. Während Meike Kamp die Bedeutung des Datenschutzes als Querschnittsthema aller digitalen Regulierungsansätze betonte, hob Andrea Sanders-Winter die Rolle der Bundesnetzagentur bei der technischen Marktaufsicht hervor. Dr. Annette Schumacher verdeutlichte, dass auch die Landesmedienanstalten zunehmend in Fragen der Plattform- und Inhaltsregulierung eingebunden seien. Am Beispiel eines KI-gestützten Chat-Assistenten, dem Nutzer interaktiv Fragen stellen oder bestimme „Experiences“ durchlaufen können, wurde deutlich, dass sich Zuständigkeitsfragen nicht leicht beantworten lassen. Von daher bestand am Ende Einigkeit darin, dass die digitale Aufsicht in Zukunft stärker kooperativ, vernetzt und europäisch gedacht werden muss.
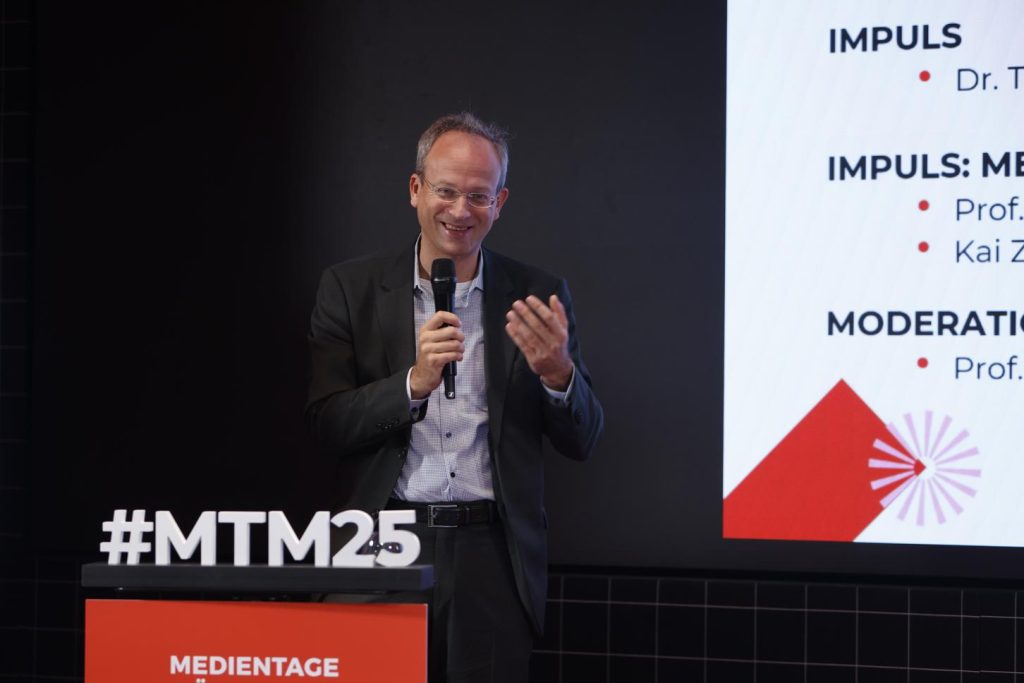











alle Bilder: Medien.Bayern GmbH